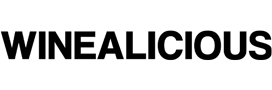Es ist eine der großen Ironien der Zeit: Während die Welt an Krisen und Katastrophen nicht eben arm ist, feiert die Haute Cuisine ihre eigenen Triumphe – gleich zwei neue 3-Sterne-Restaurants gibt es in Deutschland. Die diesjährige Verleihung der Michelin-Sterne in Frankfurt am Main – nach dem eher matten Event in Hamburg – geriet zu einer Inszenierung, die dem Anspruch des Guide Michelin endlich wieder gerecht wurde. Das Gesellschaftshaus im Palmengarten, ein Ort von urbaner Noblesse, bot die Bühne, auf der sich die Zeremonie mit wohltuender Zügigkeit, aber nicht ohne Pathos, entfaltete. Die Aftershow-Party, sonst oft ein Pflichttermin mit dem Charme eines Bankettsaals, erwies sich diesmal als Fest, das tatsächlich diesen Namen verdiente.
Doch der eigentliche Coup lag in der Partnerschaft mit der Stadt Frankfurt, die im Rahmen der Verleihung das Festival „Sterne über Frankfurt“ aus der Taufe hob. Ein kluger Schachzug, der die lokale Spitzengastronomie aus dem Elfenbeinturm der Kenner in die Wahrnehmung der breiten Masse katapultieren sollte. Bemerkenswert: Statt auf die bewährten Food-Journalisten setzte man auf Influencer – meist weiblich, meist mehr an der eigenen Inszenierung interessiert als an der Substanz des Gebotenen. Das Kalkül ging auf: Die Veranstaltungen waren ausgebucht, die Reichweite beachtlich. Ob daraus mehr als ein kurzatmiger Hype wird, bleibt abzuwarten. Die Nachhaltigkeit solcher PR-Offensiven misst sich nicht an Sonderpreisen für Erstbesucher, sondern an der Fähigkeit, aus Neugierde Stammgäste zu machen.


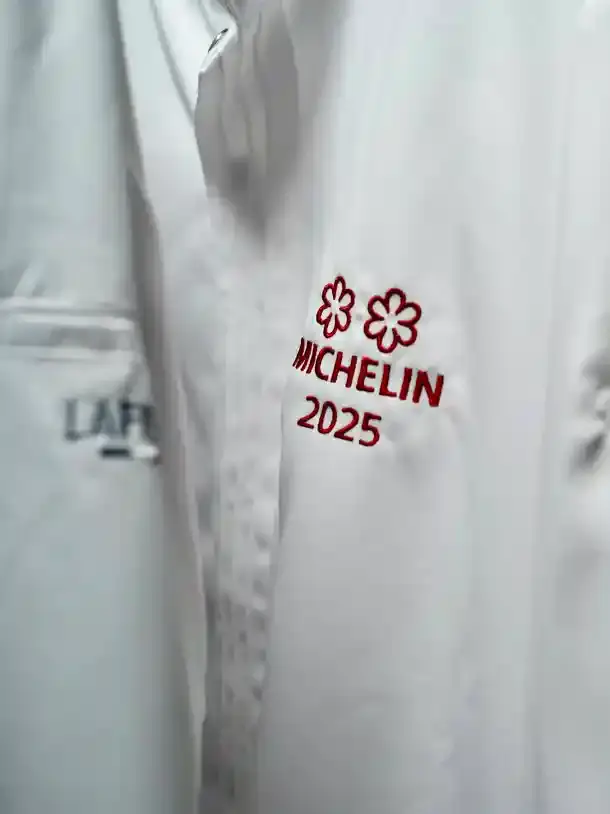
Die Inflation der Sterne – und die Relativität des Erfolgs
Wie jedes Jahr wurden auch diesmal Rekorde vermeldet: Zwei neue Dreisterner – das Haerlin in Hamburg und das Tohru in der Schreiberei in München – gesellen sich zu fünf neuen Zweisternern und 30 frisch gekürten Einsternern. Deutschland zählt nun 341 Sternerestaurants, Tendenz steigend. Gwendal Poullennec, internationaler Direktor des Guide Michelin, sprach in seiner Eröffnungsrede von Deutschland als „gastronomischem Powerhouse“. Für die ausgezeichneten Häuser mag das zutreffen, für die Breite der deutschen Gastronomie indes kaum. Das Verhältnis der Deutschen zur Kulinarik bleibt, wie der durchschnittliche Pro-Kopf-Umsatz belegt, eher pragmatisch als passioniert: 20 bis 25 Euro in einfachen bis mittleren, 60 Euro in gehobenen, 8 bis 12 Euro in Schnellrestaurants. Die Sterne allein werden das kulinarische Bewusstsein der Nation kaum heben.
Mehr noch: Der wirtschaftliche Erfolg misst sich längst nicht mehr an Sternen, sondern an der viralen Wucht der sozialen Medien. Paradebeispiel: Das Frankfurter Zenzakan, wo Christian Mook mit seinem 99,99-Euro-Katsu-Sando aus A5-Miyazaki-Wagyū nicht nur die Grenze zur steuerlichen Liebhaberei auslotet, sondern auch die Mechanismen des digitalen Marketings virtuos beherrscht. Früher nur sehr selten bestellt und deshalb fast ruinös für den Gastronomen, geht die vierteilige Vorspeise nun 600 Mal im Monat über den Tresen – ein Triumph der Inszenierung, befeuert von Influencern, die, wie Mook betont, nie gratis essen durften. Der Stern als Erfolgsmaßstab? Ein Relikt vergangener Tage.
Umgekehrt kann der Verlust eines Sterns existenzielle Folgen haben. Das Acquarello in München verlor ihn nach Ansicht von Branchenkennern folgerichtig, Wolfgang Becker in Trier hingegen wurde nach 24 Jahren Sternehistorie ohne jede Auszeichnung zurückgelassen – ein Schock, der Fragen nach der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Michelin-Urteile aufwirft. Die Definitionen des Guides – von „eine Küche voller Finesse“ bis „eine einzigartige Küche – eine Reise wert“ – sind klar, die wirtschaftliche Relevanz indes bleibt vage. Und vielleicht ist das auch gut so.
Renommee, Reputation – und die Frage nach der Unabhängigkeit
Während die deutsche Vergabe der Sterne vergleichsweise geräuschlos verlief, entzündete sich in Österreich eine Debatte, die an Grundsätzliches rührt: Wer finanziert eigentlich den Guide? In kleineren Märkten, so auch in Österreich, wird der Guide extern – sprich: durch Fördermittel – ermöglicht. Die einen sehen darin eine legitime Tourismusförderung, die anderen, vor allem Konkurrenten aus der Food-Verlagsbranche, wittern Wettbewerbsverzerrung.
Jenseits der ökonomischen Debatte stellt sich die Frage nach der Unabhängigkeit des Urteils. Das Steirereck, nun mit drei Sternen geadelt, steht exemplarisch für diese Diskussion. Warum erst jetzt? Warum war der Aufstieg für Eingeweihte so erwartbar? Und kann ein Restaurant mit 100 Couverts am Abend tatsächlich die Perfektion liefern, die drei Sterne verlangen? Die Antwort bleibt der Guide schuldig. Mein eigenes Menü im Steirereck hinterließ wenig Eindruck; Salz, Säure, Zucker – selbst im Dessert – blieben blass, die Eisnocke wirkte wie von einem Lehrling auf einer Autobahnraststätte geformt. Subjektive Wahrnehmung, gewiss, aber auch ein Plädoyer für objektive Maßstäbe, an denen sich der Guide messen lassen muss.
So bleibt ein schaler Nachgeschmack: Geld mag nicht stinken, aber manchmal schmeckt man es eben doch. Die Glaubwürdigkeit des Guide Michelin steht und fällt mit der Integrität seiner Urteile – und mit der Fähigkeit, sich nicht von Renommee, Reputation oder finanziellen Interessen leiten zu lassen. Die Frage „Quo vadis, Michelin?“ bleibt offen – und damit spannender denn je.